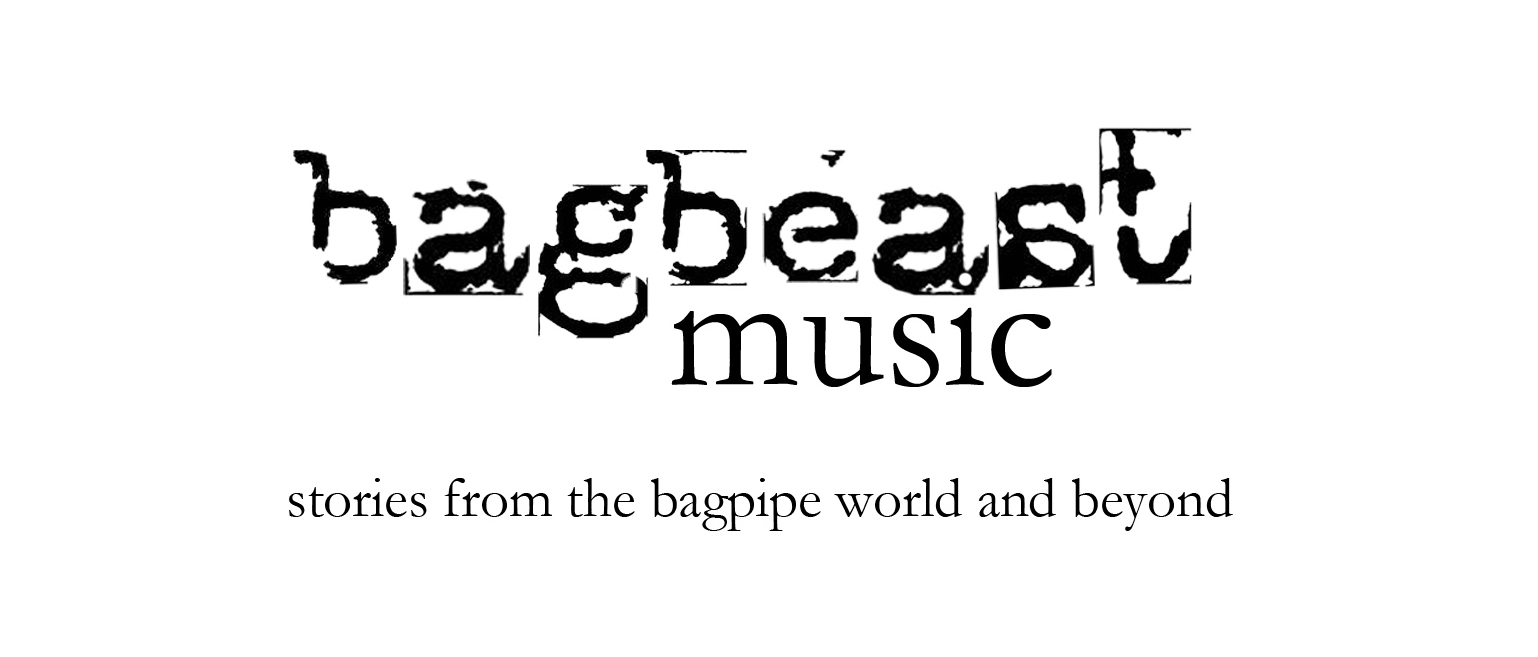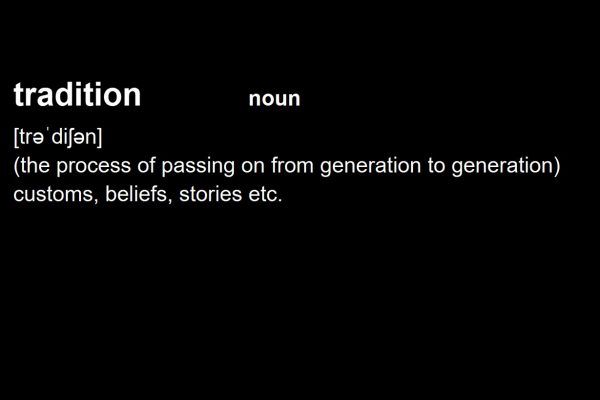Um die psychische Gesundheit von Berufsmusikern steht es offenbar nicht gut. Wie seriöse Studien zeigen, leidet rund ein Drittel unter klinisch relevanten Depressionen, Angststörungen oder Burnout. Selbstmordgedanken und Suizidversuche kommen häufiger vor als in der Gesamtbevölkerung, und bis zur Hälfte aller Musikerinnen und Musiker leidet unter Aufführungsangst. Was ist da los? Ein Gespräch mit dem klinischen Psychologen und Musiker Tobias Dolle.
An der Drehtür zum Foyer kommt er mir schon entgegen. Dem Termin waren einige Emails vorausgegangen. Nun treffe ich Tobias Dolle in einem Hotel in der Kölner Innenstadt. Der Co-Working-Space im Erdgeschoss ist gut gefüllt an diesem Montagnachmittag. Wir finden Platz auf einer Stoffcouch. Dolle stammt aus Kassel und lebt – nach Stationen in Bamberg und Mainz – seit 2022 in der Rheinmetropole. Seit 2024 ist er Mitglied im »Mental Health in Music«-Verband (MiM), einer Anlaufstelle zur Förderung der mentalen Gesundheit in der Musik- und Kreativbranche.
Auf die Frage, ob er sich zuerst als Musiker oder als Psychologe verstehe, entgegnet er, dass sich das bei ihm nicht trennen lasse und er immer schon vorgehabt habe, beides zusammenzubringen.
Eines Tages hält er einen Vortrag bei JAZZ RLP – dem Landesverband für Jazz in Rheinland-Pfalz – über psychische Gesundheit bei Berufsmusikern. Das Thema erfährt eine enorme Aufmerksamkeit und es gibt großen Gesprächsbedarf. Von der Aktualität und Dringlichkeit ist Tobias Dolle selbst überrascht. Die Veranstaltung wird für ihn, wie er rückblickend sagt, zum »Augenöffner«. Heute ist er als Berater, Dozent und Speaker zu dem Themenbereich Mental Health in der Musikbranche tätig. Ich möchte wissen, was die Menschen, mit denen er in diesem Kontext spricht, am meisten interessiert und bewegt. Das sei sehr individuell, aber – Dolle überlegt einen Moment – einige Punkte zögen sich doch durch: Selbstzweifel, Zweifel an der Tragfähigkeit der Karriere, und zwar unabhängig von bisherigem Erfolg und erreichtem Status.
Alfred Paschek: Sie sagen, es gebe einen hohen Bedarf innerhalb der Musikbranche, was die Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit und berufsbedingten Belastungen angeht. Hat sich die Situation in diesem Sektor verschlechtert?
Tobias Dolle: Ob wir aktuell wirklich eine Zunahme psychischer Erkrankungen bei Musiker:innen erleben, lässt sich wissenschaftlich nicht so ganz eindeutig sagen – dafür fehlen uns vergleichbare Studien aus früheren Jahrzehnten. Wir wissen schlicht nicht, wie es Musiker:innen in den 1980er- oder 1990er-Jahren und vorher psychisch ging, weil damals nicht systematisch dazu geforscht wurde. Was wir aber heute mit größerer Klarheit sehen, ist: Musiker:innen sind eine Risikogruppe. Studien der letzten Jahre zeigen sehr deutlich, dass Depressionen, Angststörungen, chronischer Stress und sogar Suizidgedanken unter ihnen viel häufiger vorkommen als in der Allgemeinbevölkerung.
Man kann also sagen: Ob es heute schlimmer ist als früher, wissen wir nicht – aber wir schauen heute genauer hin und wissen, dass es im Vergleich zu anderen Berufsgruppen beziehungsweise zur Allgemeinbevölkerung eher schlecht aussieht.
AP: Das Bewusstsein für diesen Problemkomplex ist also noch relativ jung?
TD: Ja, so ist es. Früher wurden psychische Probleme in der Musikbranche oft ignoriert oder romantisiert – nach dem Motto: »Genie und Wahnsinn gehören zusammen.« Systematische Forschung dazu gibt es erst seit den 1990er-Jahren, zunächst vor allem zu Bühnenangst. Die breite Beschäftigung mit Themen wie Depression, Burnout, Leistungsdruck und Selbstwertproblemen begann sogar erst ab etwa 2010, so richtig erst ab 2016. Forschende wie Musgrave, Gross, Kenny oder Fernholz haben das Thema in den letzten Jahren wissenschaftlich auf die Agenda gebracht.
Zusammenfassend könnte man dazu sagen, dass wir heute vielleicht keine neue Krise erleben, sondern eine, die eventuell schon lange da war, aber erst jetzt wirklich sichtbar wird.

Wir sprechen noch weiter über diesen Punkt, insbesondere darüber, ob die »Krise« unter Berufsmusikern, von der inzwischen die Rede ist, nicht vielmehr ein Dauerzustand sein könnte als eine schlechte Phase.
Tobias Dolle geht es auch darum, Aufmerksamkeit für diese Probleme zu schaffen und für die Interessen von Musikerinnen und Musikern einzustehen. Doch er ist kein Lobbyarbeiter. Stets ist er bestrebt, seine Aussagen auf Basis der Forschungslage zu treffen. Dazu gehört auch das Eingeständnis der aktuellen Grenzen der Erkenntnisse. Wann immer er im Gespräch diese Grenzen überschreitet und sich auf persönliche Einschätzungen oder Vermutungen stützt, macht er dies deutlich. Auch bei dieser Frage.
Es sei möglich, so Dolle, dass einige Aspekte des Musikerberufs schon immer erhöhte Risiken mit sich gebracht hätten. Zugleich aber deute für ihn vieles darauf hin, dass die Ausübung insgesamt schwieriger geworden sei und sich Umstände und Bedingungen verschärft hätten.
AP: Die positiven Effekte von Musik – ob hören oder machen – auf die Psyche sind vielfach empirisch belegt. Zur Förderung der mentalen Gesundheit ist ihr Einsatz in zahlreichen Therapiekonzepten inzwischen eine gängige Methode. Wenn man dann liest, dass gerade Berufsmusiker ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Burnout haben, wirft das Fragen auf. Wie erklären Sie diesen Widerspruch zwischen positiver Wirkung und erhöhtem Erkrankungsrisiko?
TD: Das ist ein zentraler Punkt. Obwohl Musik etwas so Schönes ist, erleben viele Menschen, die mit ihr ihren Lebensunterhalt verdienen, ihren Beruf als psychisch sehr belastend.
Musik als Tätigkeit kann heilsam wirken – etwa im Sinne von Musiktherapie oder kreativem Selbstausdruck. Aber Musik als Beruf ist mit strukturellen Belastungen verbunden, die diese positiven Effekte oft überlagern. Es sind insbesondere Leistungsdruck, finanzielle Unsicherheit, ständige Bewertung von außen, Selbstausbeutung und die psychologisch dichte Verschmelzung von Identität und Profession, die das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen.
AP: Der Druck, der vor allem durch die Arbeitsbedingungen entsteht, frisst also die positiven Effekte auf?
TD: Das trifft es genau auf den Punkt! Musiker:innen berichten häufig, dass ihre Leidenschaft durch die Arbeitsrealität regelrecht »ausgehöhlt« wird. Der Druck, sich permanent selbst zu vermarkten (Social Media!), kreativ zu bleiben, finanziell zu überleben und gleichzeitig künstlerisch integer zu bleiben (Social Media! Spotify!), erzeugt ein dauerhaftes Stressniveau. Zuverlässige Studien zeigen, dass etwa ein Drittel (ca. 30–35 %) der Musiker:innen an klinisch relevanten Depressionen oder Angststörungen leidet, mit deutlich höheren Raten subklinischer Belastungen. Die psychische Belastung ist damit nachweislich höher als in der Allgemeinbevölkerung.
AP: Die verbreitete Vorstellung vom beneidenswerten Künstler, der sich verwirklicht und beruflich seiner Leidenschaft nachgeht, bedarf also einer Korrektur?
TD: Dringend. Der romantische Mythos des freien, selbstverwirklichten Künstlers verschleiert die realen prekären Arbeitsbedingungen. Viele Musiker:innen arbeiten projektbasiert, ohne soziale Absicherung, häufig für wenig oder gar kein Geld, vertröstet mit dem Versprechen auf späteren Erfolg, aufrechterhalten vom eigenen Idealismus, Freude an der Musik etc. Diese Diskrepanz zwischen Außenwahrnehmung und Innenrealität kann psychisch sehr belastend sein – sie fördert Scham, wenn es nicht »funktioniert«, und erschwert es, Hilfe zu suchen.
Wir kommen auf ein sensibles Feld, nämlich die Angst vor Stigmatisierung und Karrierenachteilen aufgrund psychischer Probleme. Mein Gesprächspartner bestätigt, dass dies eine große Rolle spiele. In Musikerkreisen (wo berufliche und freundschaftliche Verbindungen nicht selten vermischt seien) werde so etwas kaum besprochen, etwa aus Angst, an Ansehen zu verlieren, und weil oft eine subtile Konkurrenz im Spiel ist. Dabei sieht Dolle genau hier großes Potential zur Hilfe in schwierigen Lagen. Denn ein vielversprechender Weg könne die Gründung von Peergroups für den gegenseitigen Support sein.
AP: Wie groß ist der allgemeine Aufklärungsbedarf – insbesondere beim Nachwuchs?
TD: Sehr groß. Gerade junge Musiker:innen internalisieren oft früh ein perfektionistisches Ideal und sehen psychische Belastungen als individuelles Scheitern. Dabei zeigen Studien, dass zum Beispiel Musikstudierende überdurchschnittlich häufig unter Aufführungsangst (Performance Anxiety), Depressionen und niedrigem Selbstwert leiden. Genau deshalb braucht es mehr Bewusstsein, Schutzstrukturen und konkrete Hilfsangebote für diese Gruppe. Hochschulen und Ausbildungsstätten sollten dringend Angebote schaffen, um frühzeitig über mentale Gesundheit, Risikofaktoren und Unterstützungsmöglichkeiten aufzuklären. Das sagt auch eine einschlägige Untersuchung einer EU-Kommission.
AP: Gibt es konkrete Zahlen zur Betroffenheit von psychischen Problemen bei dieser Berufsgruppe?
TD: Ja – die Datenlage ist inzwischen deutlich besser als noch vor wenigen Jahren, und wir können heute fundierter sagen, wie stark Musiker:innen tatsächlich betroffen sind:
Laut der bisher größten systematischen Übersicht zur psychischen Gesundheit in den darstellenden Künsten – der EQUITY-Studie (2022) – liegt die Prävalenz von Depressionen und Angststörungen [Anm. AP: Häufigkeit innerhalb einer bestimmten Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt] bei Musiker:innen zwischen 23 % und 36 %. Das ist deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung, wo vergleichbare Studien (z. B. UK-Mental Health Foundation) etwa 17–19 % angeben. Die oft zitierten Zahlen von 68–71 % aus der Help Musicians UK-Studie (2016) stammen aus einer nicht-repräsentativen Pilotbefragung mit freiwilligen Teilnehmenden und gelten heute als überschätzt.
Zur Suizidalität ergab die Belfast-Studie (2018), dass 60 % der Befragten aus dem kreativen Sektor bereits suizidale Gedanken hatten, 37 % einen konkreten Plan und 16 % bereits einen Suizidversuch. Im Vergleich dazu liegt die Rate suizidaler Gedanken in der Gesamtbevölkerung laut WHO meist bei 5–15 %, Suizidversuche bei etwa 4–6 %. Daraus ergibt sich ein zwei- bis vierfach erhöhtes Risiko für suizidales Verhalten bei Musiker:innen.
Zur Musikleistungs- beziehungsweise Aufführungsangst (»Music Performance Anxiety«, MPA) nennt die systematische Übersichtsarbeit von Fernholz et al. (2019) Prävalenzraten zwischen 16,5 % und 60 % für klinisch relevante Ängste bei professionellen Musiker:innen. Besonders betroffen sind jüngere Musiker:innen, Frauen und Solisten.
Seriöse Studien zeigen also, dass etwa ein Drittel der Musiker:innen (25–35 %) unter klinisch relevanten Depressionen oder Angststörungen leidet. Suizidgedanken und -versuche kommen in dieser Berufsgruppe zwei- bis viermal häufiger vor als in der Gesamtbevölkerung. Und Musikleistungsangst betrifft je nach Kontext bis zur Hälfte aller Musiker:innen – oft chronisch und unbehandelt.
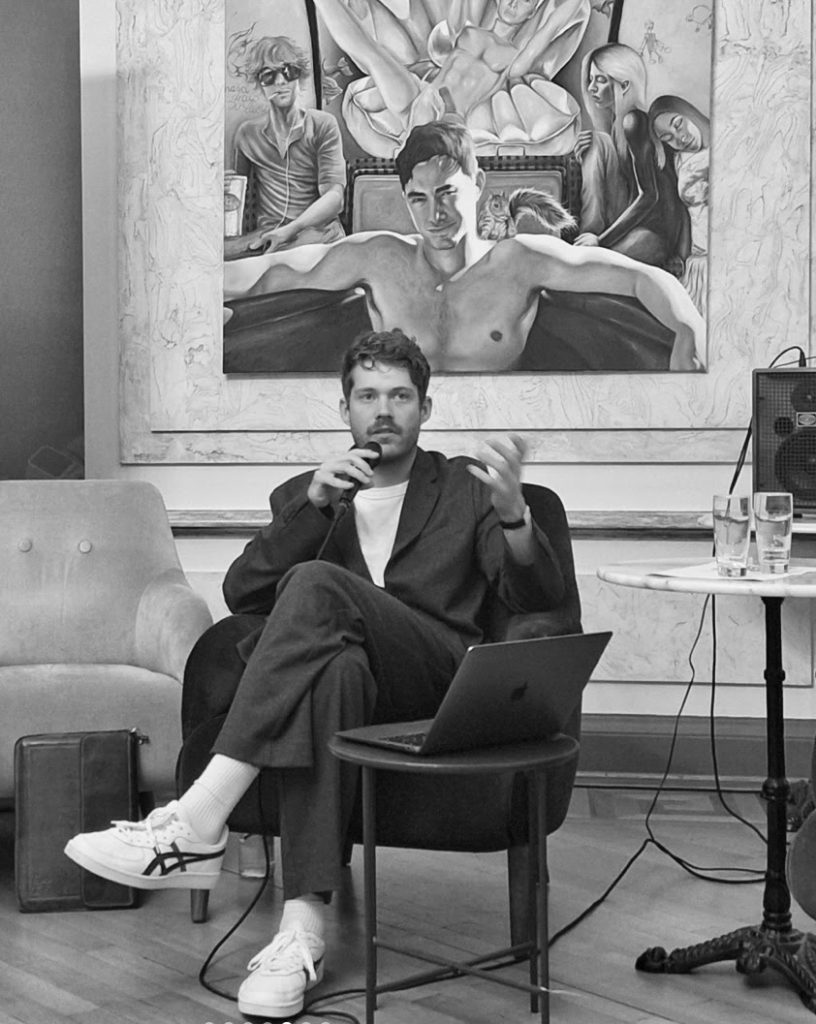
Die vorliegenden Daten und Studienergebnisse bezögen sich auf verschiedene europäische, aber auch außereuropäische Länder, ergänzt der Psychologe und Musiker. Wobei die Befunde überall sehr ähnlich seien.
Nachgefragt: Ob es nicht möglich sei, dass überproportional viele Personen den Musikerberuf ergreifen, die bereits Veranlagungen zu depressiven Episoden haben, die zu Selbstzweifeln neigen oder generell eine erhöhte Sensibilität aufweisen? Ein nennenswerter Teil mentaler Probleme innerhalb der Musikbranche wäre damit sozusagen »eingeschleppt« und weniger das Resultat interner Missstände. Die Probleme so zu verlagern, erscheint Dolle allerdings verfehlt. Er könne sich vorstellen, dass Musiker-Szenen immer schon vermehrt auch instabile Figuren und unkonventionelle Existenzen angezogen hätten. Als ursächlich für den Großteil der psychischen Leiden von Musikern sieht er jedoch die Bedingungen der Berufsausübung.
AP: Es ist offenbar ein großer Unterschied, ob ich Musik als Hobby betreibe oder meinen Lebensunterhalt damit bestreiten muss. Kann es womöglich attraktiver oder auch gesünder sein, es beim Hobby zu belassen?
TD: Diese Frage stellt sich tatsächlich. Studien deuten darauf hin, dass der Übergang von Musik als Leidenschaft zu Musik als Broterwerb mit einem drastischen Anstieg von Stress und mentaler Belastung einhergeht! »Musicians wellbeing« ist etwas ganz anderes, als der positive Zusammenhang zwischen »music and wellbeing« nahelegt. Die kreative Tätigkeit selbst bleibt erfüllend – aber sobald sie wirtschaftlich instrumentalisiert wird, kehrt sich ihr Potenzial zur Ressource ins Gegenteil.
AP: Würden Sie bestimmten Menschen vom Musikerberuf abraten?
TD: Nein. Aber ich würde zu einer ehrlichen Auseinandersetzung mit der eigenen psychischen Konstitution und mit den Realitäten des Berufs raten. Da sind wir wieder bei dem Punkt: Bildungsinstitutionen wie etwa Musikhochschulen müssen Aufklärungsarbeit leisten und Mental-Health-Fächer schaffen, wie es auch die EU-Komission empfiehlt.
Wer zu starkem Perfektionismus neigt, unter Bewertungsdruck leidet oder Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen, ist in diesem Beruf besonderen Risiken ausgesetzt. Doch die Medaille hat zwei Seiten. Denn für den musikalischen Erfolg können solche Eigenschaften auch hilfreich sein. Ich bin überzeugt, dass gewisse Vulnerabilitäten auch positive Effekte auf persönliches Wachstum und berufliches Fortkommen haben können – das gilt besonders für kreative Berufe. Wer kreativ ist, kann auch kreativ auf Karrierefragen reagieren (z. B. indem man Marktlücken findet, sein breites Interesse nutzt für Zuverdienste im Sinne einer Portfoliokarriere etc.). Entscheidend ist, jungen Musiker:innen eine BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG zu ermöglichen, was der Beruf letztendlich bedeutet, ohne Angst zu machen.
AP: Woran kann ich erkennen, dass mit mir selbst oder mit jemandem in meinem Umfeld psychisch etwas nicht stimmt? Was sollte ich dann tun?
TD: Im Sinne klinisch bedeutsamer, therapiebedürftiger Symptome? Warnzeichen könnten sein: anhaltender Leistungsdruck, Schlafprobleme, emotionale Erschöpfung, sozialer Rückzug, Suizidgedanken, diffuser innerer Druck, Angst- oder Panikzustände. Unterm Strich: Leid. In diesen Fällen sollte man nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen – je früher, desto besser. Zugleich ist es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem über psychische Probleme gesprochen werden kann, ohne dass dies als Schwäche gewertet wird. Und mir ist wichtig, zu betonen: Eine klinische Diagnose wie Depression oder Angststörung erfordert eine Psychotherapie bei einer approbierten psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeutin – kein Coaching, keine Beratung, keinen Heilpraktiker (auch nicht Heilpraktiker für Psychotherapie)!
AP: Man kann den Eindruck gewinnen, dass wir in zunehmend überreizten, hypernervösen Stressgemeinschaften leben. Sind wir eigentlich noch zu retten?
TD: Das ist eine ziemlich großformatige Frage. Ich beschränke mich mal auf unser Thema in der Musikbranche. Nach meinen Beobachtungen und in meinem psychologischen Verständnis kann ich sagen: Kreativität braucht eigentlich Leere, Unschärfe, Unverfügbarkeit – aber diese Zustände haben in der heutigen Kulturindustrie kaum mehr Platz. Der ständige Blick auf Reichweiten, Streamingzahlen, Likes und Follower erzeugt ein Klima der Dauerpräsenz. Wer nicht sichtbar ist, wird vergessen. Wer nicht messbar ist, ist scheinbar wertlos. Und Sichtbarkeit ist keine bloße Eitelkeit – sie ist oft überlebensnotwendig, denn mit dem Einbruch klassischer Einnahmequellen (wie CD- oder Ticketverkäufen) ist Aufmerksamkeit zur Währung geworden. Musiker:innen kämpfen nicht mehr nur um künstlerische Relevanz, sondern um ökonomische Existenz.
Zudem ersetzt Sichtbarkeit zunehmend Qualität. Eine Studie zu virtuellen kulturellen Märkten (Salganik et al., „MusicLab“, 2006) zeigt klar: Erfolg in digitalen Märkten hängt nicht primär von künstlerischer Qualität ab, sondern von sozialem Einfluss und frühen Sichtbarkeitsschüben. Wer am Anfang viel Aufmerksamkeit bekommt, wird weiter nach oben »gespült« – der Inhalt ist dabei sekundär. Das ist der sogenannte Matthäus-Effekt (wer hat, dem wird gegeben). Die Folge ist eine kreative Verzerrung: Musiker:innen, die finanziell auf ihren Output angewiesen sind, sind gezwungen, wiedererkennbare, algorithmusfreundliche und genrekonforme Inhalte zu produzieren – weil alles andere unsichtbar bleibt. Das Neue, Widersprüchliche, Experimentelle, von innen heraus Kommende hat es schwer in einem System, das vor allem Wiedererkennbarkeit belohnt.
Was Theodor W. Adorno in der Kulturindustrie des 20. Jahrhunderts beschrieben hat – nämlich die Verwaltung und Standardisierung von Kunst im Kapitalismus –, erreicht heute einen neuen Höhepunkt. Die Quantifizierung kreativen Schaffens, der plattformspezifische Vergleichsdruck und die ökonomische Verwertung von Aufmerksamkeit führen dazu, dass viele Künstler:innen gar nicht mehr frei arbeiten können. Und noch etwas hat sich verändert: Heute können Maschinen selbst Kulturprodukte erstellen. Tools wie SUNO erzeugen KI-generierte Songs in Sekunden – vollständig, stilistisch perfekt, technisch makellos. Das bedeutet: Nicht nur Menschen stehen im Vergleich zueinander, sondern Menschen stehen auch hier in Konkurrenz zu Maschinen, die keine Pausen, keine Krisen, keine Unsicherheiten kennen.
Und zu der Frage, ob wir noch zu retten sind: Ja – aber nur, wenn wir den inneren Raum verteidigen, in dem Kunst entstehen kann. Einen Raum jenseits von Markt, Plattform und Algorithmus. Das ist keine nostalgische Utopie – sondern ein psychologisches Grundbedürfnis. Ohne diesen Raum verkümmert nicht nur die Kunst – sondern auch der Mensch dahinter.