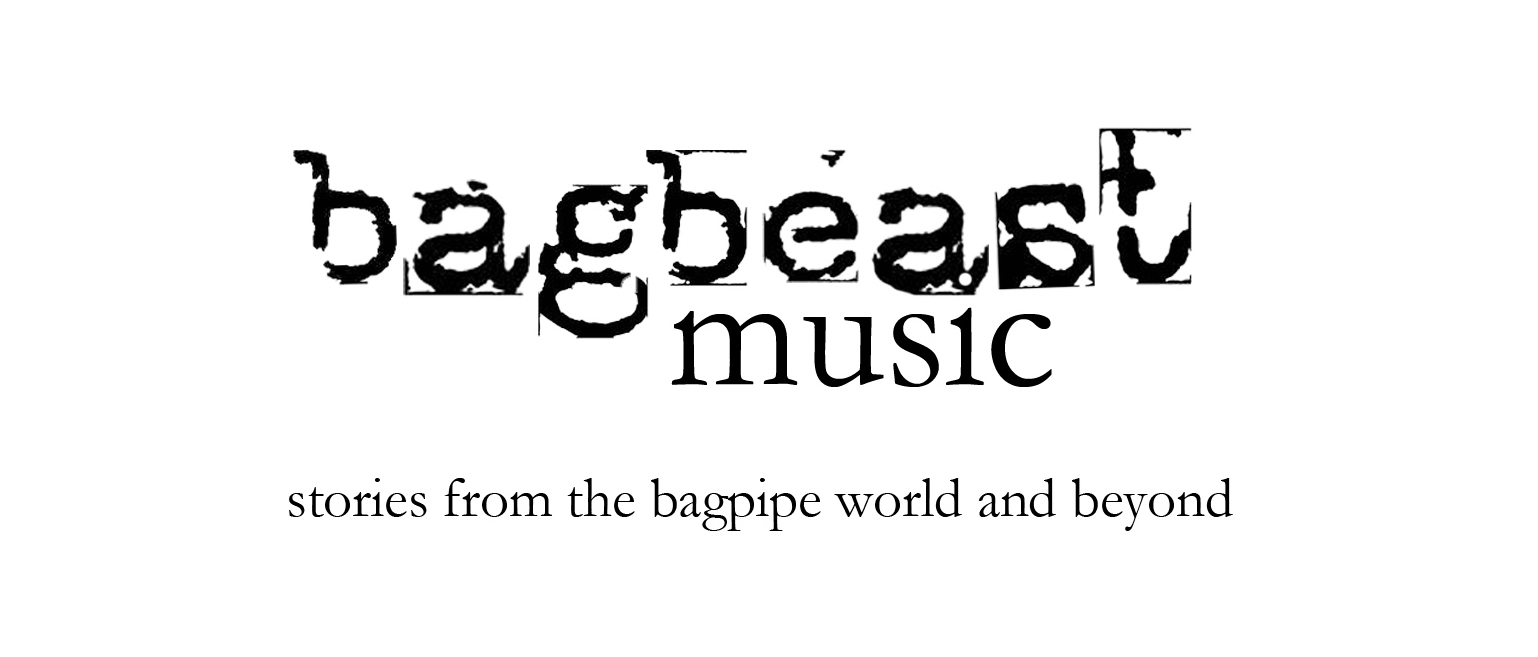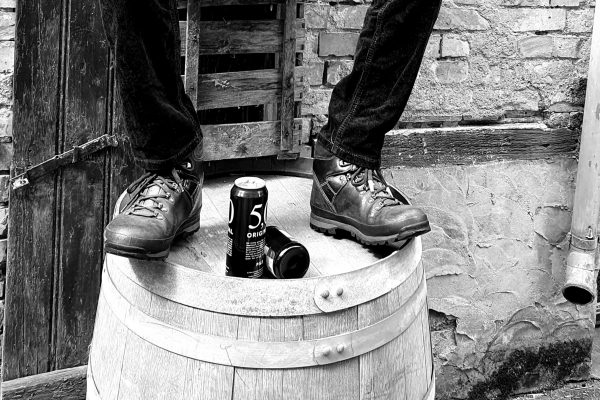Dudelsack spielen ist anstrengend. Man muss nur lange genug mit dem Instrument kämpfen, um es irgendwann bändigen und ihm Musik abringen zu können. Es kommt vor, dass solche und ähnliche Vorstellungen vom eigenen Instrument als Kontrahent, den es zu bezwingen gelte, von Mitstreitern gepflegt und von individuellen Lernerfahrungen bestätigt werden. Muss das so sein?
Joachim Schiefer antwortet darauf mit einem klaren »Nein« und weist auf einen ihm wichtigen Zusammenhang hin: »Wenn ich die Vorstellung habe: ›Das ist schwer‹, dann nehme ich automatisch eine entsprechende, fürs Spielen ungünstige Haltung ein.« Dass das Instrument in einem guten, spielfähigen Zustand sein sollte und dass zum Erlernen desselben auch Mühe und Anstrengung dazugehören können, ist dem professionellen Cellisten natürlich klar. Zugleich aber weiß er, dass der Weg zur Musik in vielen Fällen unnötig beschwerlich und manchmal auch verbaut ist.
Hilfe durch Dispokinesis
Es war Mitte der 90er Jahre, als Joachim Schiefer selbst in Schwierigkeiten geriet: Spielunfähigkeit durch fokale Dystonie – in spezifischer Form auch als Musiker-Dystonie bekannt. Es handelt sich dabei um eine neurologische Erkrankung, die die Ausführung bereits erlernter, komplexer und präziser Bewegungen stört. Für den Berufsmusiker eine Katastrophe. Hilfe findet er zunächst nicht. Die Verzweiflung wächst. Dann stößt er auf die Therapieform der Dispokinesis, die maßgeblich der niederländische Pianist und Physiotherapeut Gerrit Onne van de Klashorst (1927–2017) in den 1950er Jahren entwickelt hatte. Man könnte Dispokinesis als bewegungspädagogisches Schulungskonzept bezeichnen, bei dem es – einfach gesprochen – um psycho-physische Voraussetzungen des Musizierens geht. Durch intensive Auseinandersetzung vor allem mit Haltung, Atmung und Bewegung sowie mit inneren Einstellungen und mentalen Prozesse sollen musikalische Spiel- und Ausdrucksfähigkeit erhalten, verbessert oder wiedererlangt werden.
Schiefer nimmt damals Kontakt zu van de Klashorst auf und findet Hilfe. Er wird dessen Schüler und absolviert eine dreijährige Ausbildung zum Dispokineter in Düsseldorf. Insgesamt durchläuft er einen siebenjährigen Lernprozess, in dem er sein motorisches Bewusstsein am Cello von Grund auf ändert. Schließlich erlangt er seine uneingeschränkte Spielfähigkeit wieder. Heute gibt er Kurse, Workshops und Seminare zu unterschiedlichen Aspekten der Musikermotorik. Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit ist er regelmäßig zu Gast in der Dudelsack-Akademie in Hofheim am Taunus. Schwerpunkte dieser Veranstaltungen bilden grundlegende physische Zusammenhänge und der Einfluss von Körper- und Instrumentalhaltung auf die Motorik beim Dudelsackspiel.


Rund zehn Teilnehmer…
haben sich an diesem Samstagmorgen im April in einem Seminarraum des historischen Kellereigebäudes in Hofheim eingefunden. Außer mit ihren Instrumenten – Highland Bagpipes, Smallpipes, verschiedene Mittelalterdudelsäcke – sind sie mit Wolldecken und Isomatten bepackt. Inhaltlich werden in den nächsten sieben Stunden Begriffe wie »Gefühl«, »Vorstellung«, »Stabilität« und »Haltung« eine zentrale Rolle spielen, und die Teilnehmer werden Gelegenheit haben, anhand praktischer Übungen ihre Körperwahrnehmung zu schulen und mentale Dispositionen zu hinterfragen. »Was ist mein Grundgefühl beim Spielen?« ist so eine Frage, die scheinbar simpel daherkommt, die aber, lässt man sich erst einmal darauf ein, ganz unerwartete Einsichten in die eigene musikalische Praxis eröffnen kann. Denn sie lenkt die Aufmerksamkeit auf einen oftmals blinden Fleck. Ist es Anstrengung, Überforderung, Unwohlsein? Oder ist es eher ein Hochgefühl? Vielleicht Freude, Sicherheit, Glück? »Wir spielen immer aus einem individuellen Gefühl heraus«, so der Dispokineter aus Wuppertal. Man müsse das Gefühl kennen, aus dem heraus etwas gelinge, und es unter Kontrolle bringen lernen. Dann lasse es sich sogar gezielt herstellen und einsetzen, um beispielsweise in ungewohnten Umgebungen Nervosität abzubauen.
Von der Vorstellung zur Bewegung
Joachim Schiefer ist besonders daran gelegen, die Relevanz von Vorstellungen und Körperhaltungen für eine angemessene Bewegungsfähigkeit beim Musizieren herauszustellen. Beides – Haltung und Bewegungsvorstellung – habe entscheidenden Einfluss auf die Motorik am Instrument. Anschauliches Beispiel: Sein Lehrer, van de Klashorst, habe als Pianist die Vorstellung schwebender Hände am Klavier gepflegt, um die feinmotorische Funktionalität zu fördern, erinnert sich Schiefer. Mit Blick auf die Instrumente in diesem Workshop könnte man sagen: Wer denkt, »ich halte den Chanter in Händen«, der macht sich das Leben vielleicht schon schwer, weil er einem Bild folgt, das Spannungen und allzu feste Griffe hervorrufen kann. Und wer nach einer möglichen Alternative zum »Greifen« und »Festhalten« sucht, kommt unter Umständen mit der »Berührung« besser zurecht.
Klar ließe sich ein Dudelsack auch als Sportgerät begreifen, das mit hohem körperlichen Einsatz zum Klingen gebracht wird. Ein ermüdungsarmes Spiel und technische Raffinesse ließen sich allerdings, darauf weist Schiefer mehrfach hin, nur mittels energieeffizienter Feinmotorik erzielen. Und dafür brauche es neben dem passenden Mindset auch eine Freiheit im Oberkörper, die von einer stabilen Körpermitte gewährleistet werde. Auf Decken und Matten liegend, erproben die Teilnehmer verborgene Muskelpartien, um sich über Voraussetzungen ihrer physischen Stabilität klarzuwerden.
Im Laufe der Veranstaltung wird deutlich, worin eigentlich spezifische Herausforderungen dieser Instrumente bestehen. Auf den Punkt gebracht, ist es besonders die erforderliche Trennung von grob- und feinmotorischen Prozessen, die synchron laufen, sich aber nicht beeinflussten sollten. Dies zeigt sich – bei Rechtshändern – vor allem im linken Arm. Während dieser mit grobmotorischen Aktionen konstant Druck ausübt, benötigt die Hand größtmögliche Freiheit für präzise Bewegungen. Die Kurzanleitung für eine Entkopplung dieser Abläufe könnte lauten: Stabilität im Zentrum und Ausbildung der feinmotorischen Spielfähigkeit der Hände, das heißt, Vermeidung unnötiger Bewegungsaktivität (Wegstrecken der Finger über den Löchern) bei möglichst geringem Kraftaufwand. »Um die Kontrolle über die Löcher zu haben, ist es gar nicht nötig, die Finger mit mehreren Kilogramm Gewicht darauf zu pressen«, gibt Schiefer zu bedenken.


Lektion über Leichtigkeit
Gelegentlich tritt der Dozent aus dem thematischen Rahmen des Workshops heraus und demonstriert die Anschlussfähigkeit an weitere Fragestellungen. So zum Beispiel, wenn er die generelle Abwertung von Gefühl und Intuition als gesellschaftliches Problem ausmacht oder den zunehmenden Verlust feinmotorischer Fähigkeiten bei jungen Menschen beklagt. Solche Wertungen aber sind die Ausnahme. Schiefer sagt selten »So ist es!«, sein Angebot ist vielmehr ein »es kann sein«.
Es dauert ein wenig, bis all die Details über psychische Erfahrungen und anatomische Aspekte sich zu einem Gesamtbild fügen. Je weiter die Veranstaltung voranschreitet, desto konzentrierter und auch nachdenklicher wirken viele Teilnehmer. Anschließend wird es an jedem einzelnen liegen, aus der Vielzahl an Hinweisen und Kenntnissen das mitzunehmen und in den musikalischen Alltag zu integrieren, was für sie oder ihn hilfreich ist. In jedem Fall dürfte dieser Tag einen neuen Horizont aufgerissen haben, in dem der Umgang mit dem Musikinstrument in einem neuen Blickwinkel erscheint. Eine Teilnehmerin bestätigt dies, als wir nach dem siebenstündigen Kurs die schwere Holztreppe des Kellereigebäudes ins Erdgeschoss hinuntergehen. In vielen Unterrichtssituationen liege der Fokus – verständlicherweise – auf der Musik und den Fingern, während der ganze psycho-physische Komplex, der die musikalische Aktivität überhaupt erst ermögliche, kaum oder gar keine Aufmerksamkeit erfahre, berichtet sie aus eigener Erfahrung.
Der größte Gewinn dieser Fortbildung mit dem Titel »Der Körper, unser wertvollstes Instrument« mag allerdings darin bestehen, dass es eigentlich um mehr geht als die Handhabung von Musikinstrumenten. Nämlich um ein Lebensgefühl. Darum, wie wir täglich in unsere Umgebung hinaustreten – als geschundene Nervenbündel oder als positive Frohnaturen, die im günstigen Fall auch noch so etwas wie Musik zustande bringen.
Ja, wenn es leicht wäre. Das Musizieren, das Leben. Ein Wunschtraum gewiss. Von dem sich vielleicht aber mehr realisieren lässt, als wir anzunehmen uns erlauben.
Joachim Schiefer
Thomas Zöller